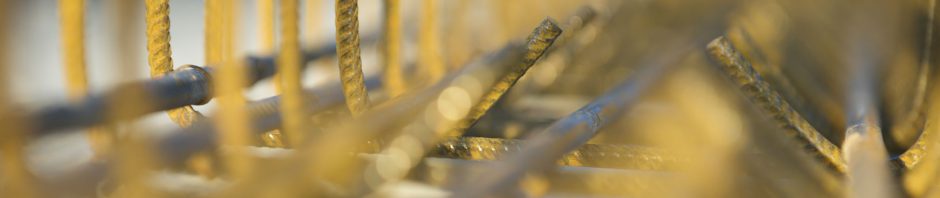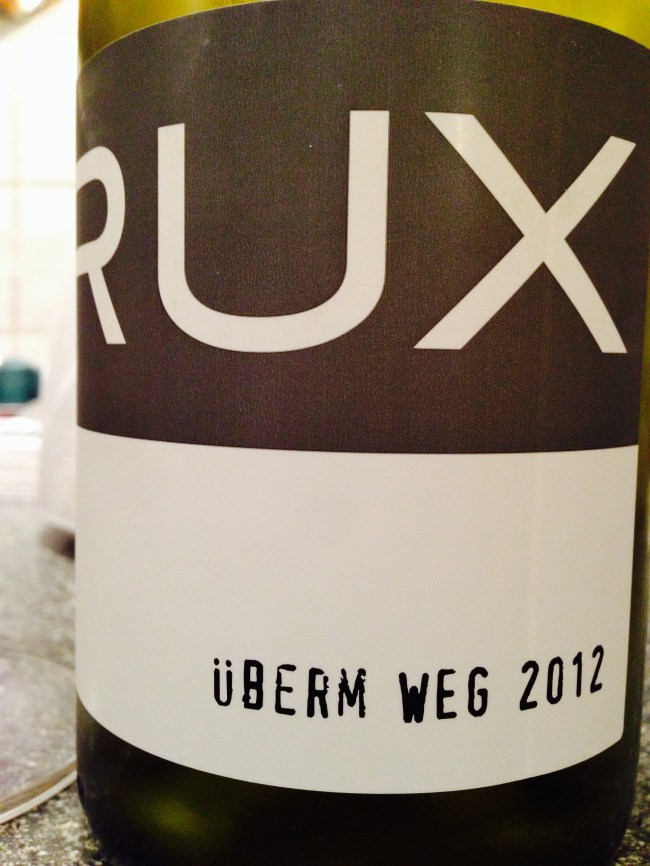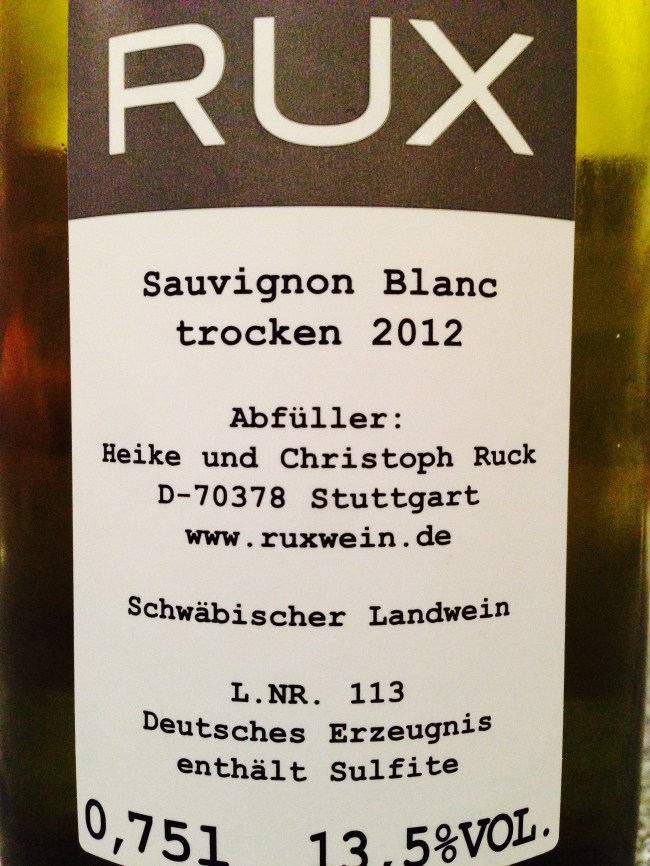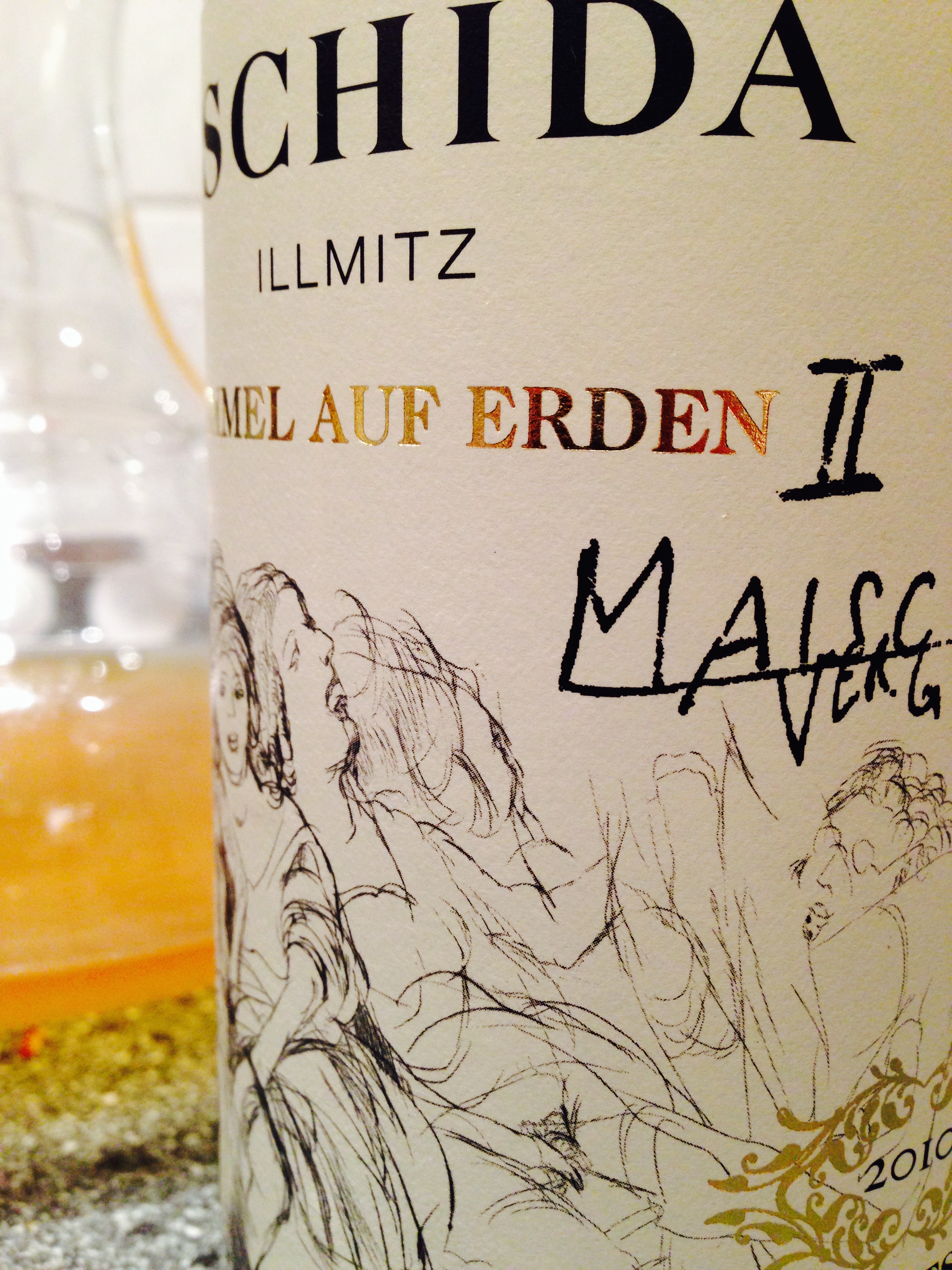RSS
-
Schließe dich 3 anderen Abonnenten an
Blogroll
Erinnerung an Gisbert Beck – Ein Held meiner Kindheit
Gisbert Beck – 15.000 Tage
Der erste Amoklauf – ein Schock fürs Leben.
Heute ist es 15.000 Tage her, dass ein Amoklauf tiefe Spuren in meinem Gefühlsleben und meinen Gedanken hinterlassen hat. Für immer.
Der erste, spontan notierte Titel dieses Beitrags lautete: „Vor 15.000 Tagen wurde ich Opfer eines Amoklaufs.“ Das stimmt, so fühlt es sich an. Und doch finde ich den Titel unpassend und unangemessen, vor allem, weil ich eines der kleinsten, unwichtigsten Opfer dieses Horrors bin, geradezu vernachlässigbar, ohne unmittelbare Betroffenheit. Die wahren Opfer, derer ich immer wieder gedenke, die die fünf Getöteten, die 14 Verletzten, deren Angehörige und Freunde, die Kinder, die diesen Horror miterleben mussten, die Lehrer, die Helfer, Einsatzkräfte, die Menschen in der Gemeinde… Was für ein großes, unermessliches Leid.
Am 3. Juni 1983 wurden viele Menschen Opfer eines Mörders in einer Schule in Eppstein-Vockenhausen.
Elf Jahre war ich alt, als ich von diesem schrecklichen Ereignis erfuhr. Es war ein Schock, der mich seit 41 Jahren immer wieder einholt. Nicht auszudenken, wie es wohl den Hinterbliebenen geht.
Was habe ich nun mit alldem zu tun? Meine persönliche Verbindung zu diesem Ereignis ist der Polizist Gisbert Beck. Zusammen mit einem Kollegen war er mit der Jugendverkehrsschule des Main-Taunus-Kreises immer wieder in meiner Grundschule zu Gast, um uns Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr beizubringen. Die Grundschule Hattersheim hatte einen zur Hauptstraße gelegenen geteerten Schulhof, der mit Straßenlinien für solche Zwecke bemalt war. Die Polizisten hatten Fahrräder dabei, Ampeln, Schilder und alles, was für die Simulation der echten Verkehrswelt da draußen wichtig war. Sie kamen mit einem Lkw von Mercedes-Benz – das war nicht wichtig, aber sowas merkte sich der Junge eben – und hatten mich sehr beeindruckt. Vor allem Gisbert Beck, damals 43 Jahre alt und aus meiner Perspektive schon ein alter Erwachsener, als Polizist noch eine besondere Respektsperson. Er war schlanker als mein Opa, erinnerte mich aber vom Gesicht und seiner Art an ihn. Das gab bei mir von vornherein Sympathiepunkte. Auch in Erinnerung geblieben ist mir seine wunderbare Art, mit uns Kindern umzugehen. Verständliche Erklärungen, unermüdliche Geduld, Zugewandheit, eine angemessene Strenge bei der Vermittlung von Regeln und dem Erläutern von Gefahren, und dabei immer von einem positiven, freundlichen Gemüt. Der Typ war sensationell und ich fand (und finde) ihn weltklasse. Was für ein toller Polizist und Pädagoge! Herr Beck ist ein Held meiner Kindheit.
Aus der Grundschule war ich raus, als ich auf mir heute nicht mehr bekanntem Wege vom Tode Becks erfuhr. In den Nachrichten kamen Berichte, vom toten Lehrer, von den toten Schülern – meinesgleichen! – unfassbar – und schließlich die Gewissheit, dass ein Held meiner Kindheit umgebracht worden war. Hessenschau? Tagesschau? Ich weiß es nicht mehr, erinnere mich nur schemenhaft an fragmentarische Bildreste, die sich in meinem Hirn eingebrannt haben.
Das saß. Und es sitzt bis heute, denn Gedanken an die Tat, die Opfer und insbesondere Gisbert Beck kommen immer wieder hoch.
Den 40. Jahrestag letztes Jahr habe ich verpasst. Doch die Tage habe ich berechnet. Und so sind es heute eben 15.000 Tage. Auch ein würdiger Zeitpunkt, der Opfer zu gedenken.
In memoriam
Stefanie Herrmann
Javier Martinez
Gabriele Siebert
Hans-Peter Schmitt
Gisbert Beck
Lieber Herr Beck, ich werde Sie nie vergessen!
Der erste Amoklauf – ein Schock fürs Leben.
Heute ist es 15.000 Tage her, dass ein Amoklauf tiefe Spuren in meinem Gefühlsleben und meinen Gedanken hinterlassen hat. Für immer.
Der erste, spontan notierte Titel dieses Beitrags lautete: „Vor 15.000 Tagen wurde ich Opfer eines Amoklaufs.“ Das stimmt, so fühlt es sich an. Und doch finde ich den Titel unpassend und unangemessen, vor allem, weil ich eines der kleinsten, unwichtigsten Opfer dieses Horrors bin, geradezu vernachlässigbar, ohne unmittelbare Betroffenheit. Die wahren Opfer, derer ich immer wieder gedenke, die die fünf Getöteten, die 14 Verletzten, deren Angehörige und Freunde, die Kinder, die diesen Horror miterleben mussten, die Lehrer, die Helfer, Einsatzkräfte, die Menschen in der Gemeinde… Was für ein großes, unermessliches Leid.
Am 3. Juni 1983 wurden viele Menschen Opfer eines Mörders in einer Schule in Eppstein-Vockenhausen.
Elf Jahre war ich alt, als ich von diesem schrecklichen Ereignis erfuhr. Es war ein Schock, der mich seit 41 Jahren immer wieder einholt. Nicht auszudenken, wie es wohl den Hinterbliebenen geht.
Was habe ich nun mit alldem zu tun? Meine persönliche Verbindung zu diesem Ereignis ist der Polizist Gisbert Beck. Zusammen mit einem Kollegen war er mit der Jugendverkehrsschule des Main-Taunus-Kreises immer wieder in meiner Grundschule zu Gast, um uns Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr beizubringen. Die Grundschule Hattersheim hatte einen zur Hauptstraße gelegenen geteerten Schulhof, der mit Straßenlinien für solche Zwecke bemalt war. Die Polizisten hatten Fahrräder dabei, Ampeln, Schilder und alles, was für die Simulation der echten Verkehrswelt da draußen wichtig war. Sie kamen mit einem Lkw von Mercedes-Benz – das war nicht wichtig, aber sowas merkte sich der Junge eben – und hatten mich sehr beeindruckt. Vor allem Gisbert Beck, damals 43 Jahre alt und aus meiner Perspektive schon ein alter Erwachsener, als Polizist noch eine besondere Respektsperson. Er war schlanker als mein Opa, erinnerte mich aber vom Gesicht und seiner Art an ihn. Das gab bei mir von vornherein Sympathiepunkte. Auch in Erinnerung geblieben ist mir seine wunderbare Art, mit uns Kindern umzugehen. Verständliche Erklärungen, unermüdliche Geduld, Zugewandheit, eine angemessene Strenge bei der Vermittlung von Regeln und dem Erläutern von Gefahren, und dabei immer von einem positiven, freundlichen Gemüt. Der Typ war sensationell und ich fand (und finde) ihn weltklasse. Was für ein toller Polizist und Pädagoge! Herr Beck ist ein Held meiner Kindheit.
Aus der Grundschule war ich raus, als ich auf mir heute nicht mehr bekanntem Wege vom Tode Becks erfuhr. In den Nachrichten kamen Berichte, vom toten Lehrer, von den toten Schülern – meinesgleichen! – unfassbar – und schließlich die Gewissheit, dass ein Held meiner Kindheit umgebracht worden war. Hessenschau? Tagesschau? Ich weiß es nicht mehr, erinnere mich nur schemenhaft an fragmentarische Bildreste, die sich in meinem Hirn eingebrannt haben.
Das saß. Und es sitzt bis heute, denn Gedanken an die Tat, die Opfer und insbesondere Gisbert Beck kommen immer wieder hoch.
Den 40. Jahrestag letztes Jahr habe ich verpasst. Doch die Tage habe ich berechnet. Und so sind es heute eben 15.000 Tage. Auch ein würdiger Zeitpunkt, der Opfer zu gedenken.
In memoriam
Stefanie Herrmann
Javier Martinez
Gabriele Siebert
Hans-Peter Schmitt
Gisbert Beck
Lieber Herr Beck, ich werde Sie nie vergessen!
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit Amoklauf, Eppstein, Erinnerung, Gisbert Beck, Grundschule, Held, Kindheit
Hinterlasse einen Kommentar
Max Reger – Acht geistliche Gesänge op.138
Transkript einer Audioaufzeichnung vom 10.08.2018 im Auto auf der A8
Die Musik Max Regers ist so dicht, man kann sie förmlich anfassen.
Meine Gänsehaut reibt sich an den Sekunden der Regerschen Musik.
Harmonien so dicht, dass man sie spürt.
Wie Reger in einer kurzen Wendung ein „Kyrie eleison“ zu Licht werden lässt, wie er dort akustisch Helligkeit hörbar macht; kleinste Wendungen dieser musikalischen Miniaturen, von denen ich bedaure, dass sie anderthalb, zweieinhalb, vielleicht drei Minuten lang sind und nicht 13, 20 oder 30 Minuten.
Ein Fest für alle die Chormusik mögen, die mit Romantik was anfangen können, die Offenheit für die durchaus progressive Harmonik mitbringen, dort wo es mal eng wird, aber immer warm bleibt. Und wo sich der akustische Reiz verdichtet und, so komplex es auch sein mag, man förmlich in eine wohlstrukturierte Watte hineinfällt.
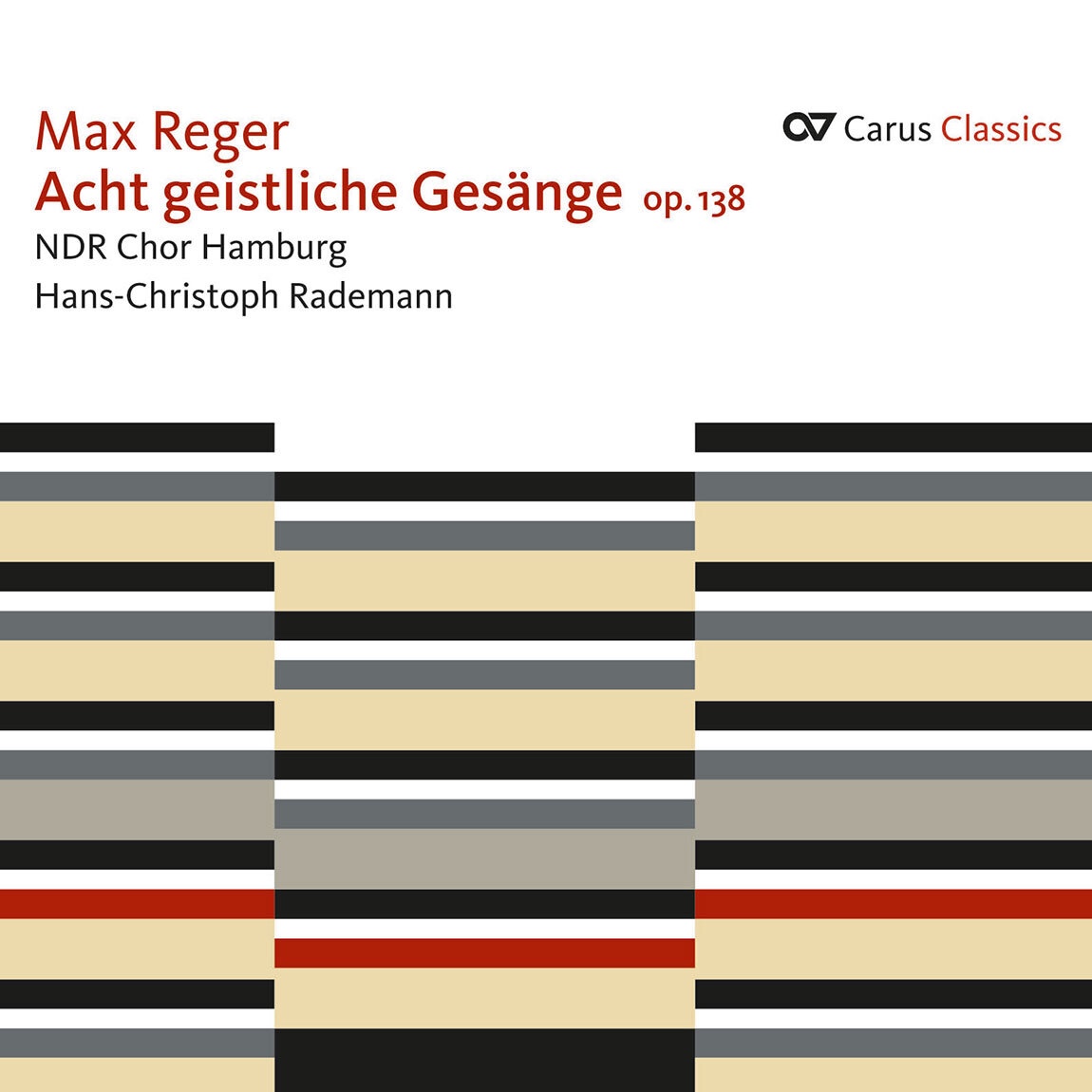
Veröffentlicht unter Allgemein
Hinterlasse einen Kommentar
Dieseldebatte
Dieseldebatte
https://edition.faz.net/faz-edition/politik/2019-04-01/1cae45a6ef2c974347f1870497f86e5e?GEPC=s9
MONTAG, 01.04.2019
F.A.Z. – DIE GEGENWART
Teufel oder Beelzebub
Mit der Festlegung von wissenschaftlich nicht begründbaren Grenzwerten für Stickstoffdioxid hat die Politik Deutschland in die Diesel-Falle gesteuert. Und nur die Politik kann das Land aus dieser Falle befreien. Einstweilen muss die Justiz die Schieflage zwischen dem gesetzlichen Grenzwert, den Handlungsoptionen der Gemeinden und den Rechten der Bürger korrigieren.
Von Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Alexander S. Kekulé
Der Streit über Diesel-Fahrverbote hat neuerdings die Wissenschaft erfasst, und das mit geradezu selbstzerstörerischer Wucht. Seit im Januar rund hundert Lungenärzte und Ingenieure die für die EU geltenden Grenzwerte kritisierten und ein Gutachten des Umweltbundesamtes in Frage stellten, bewerfen sich distinguierte Doktoren öffentlich mit Dreck. Die Autoren des Papiers werden als „Außenseiter“ und „Exoten“ beschimpft, die nichts als eine „Stammtischdiskussion älterer Ärzte“ führten. Ihre Einwände gegen die Grenzwerte seien „befremdlich“, „unwissenschaftlich“ und „total daneben“. Als dann auch noch herauskam, dass sich der Anführer der aufständischen Zenturie, der Lungenfacharzt Dieter Köhler, an mehreren Stellen verrechnet hatte, war nicht nur unter Umweltmedizinern die Häme groß.
War die Revolte der Lungenärzte also nur eine Luftnummer? Sind die wissenschaftlichen Fakten so eindeutig, dass sie die Sperrung ganzer Innenstädte für ältere Dieselfahrzeuge rechtfertigen? Muss der Staat seinen Bürgern Beschränkungen der Mobilität und wirtschaftliche Nachteile zumuten, um sie vor einer ernsten Gesundheitsgefahr zu schützen?
Fast alles, was Köhler und Kollegen in ihrem Positionspapier geschrieben und gerechnet haben, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Ihre pauschale Verharmlosung der Luftverschmutzung steht im Widerspruch zu aktuellen Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die darin das weltweit größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko sieht. Jedoch hat der streitbare Pensionär, wie die überzogene Reaktion der etablierten Szene erahnen lässt, an einem Punkt den Finger in eine offene Wunde gelegt. In einem Halbsatz moniert er sinngemäß, der Grenzwert für Stickstoffdioxid sei wissenschaftlich nicht begründet – und damit hat er recht.
Die Fahrverbote werden aufgrund einer EU-Richtlinie verhängt, wonach die Konzentration von Stickstoffdioxid in der Außenluft im Jahresmittel 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) nicht überschreiten darf. Dieser Grenzwert war von Anfang an nicht wissenschaftlich, sondern politisch begründet. Nach dem Umweltgipfel von Rio de Janeiro im Jahr 1992 wollte die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangehen. Ehrgeizige Luftqualitätsziele sollten die Industrie zwingen, bessere Reinigungssysteme für Fabrikschlote sowie schadstoffärmere Autos zu entwickeln.
Stickstoffdioxid galt damals als einfach zu messender Anzeiger für Verbrennungsabgase aller Art. Es entsteht in jeder Flamme und hat im Gegensatz zu vielen anderen Schadstoffen keine relevanten natürlichen Quellen. Der damals gültige Grenzwert von 200 µg/m3 sollte deshalb deutlich verschärft werden. Der Industrie wollte man ausreichend Vorlauf geben, um die technischen Voraussetzungen zu entwickeln.
Doch die Vorgabe der Politik stellte die Wissenschaft vor eine unlösbare Aufgabe. Laut einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 1985 müssen die Grenzwerte auf Empfehlungen der WHO beruhen, „und zwar vor allem auf den für diesen Schadstoff ermittelten Relationen zwischen Dosis und Wirkungen“. Damals wie heute gab es keine Experimente, die eine biologische Wirkung von Stickstoffdioxid in den geringen, in der Außenluft gemessenen Konzentrationen zeigen. Ohne Kenntnis der Dosis-Wirkungs-Beziehung kann jedoch kein Grenzwert berechnet werden.
Die Abhängigkeit der Gesetzgebung von einem Vorschlag der WHO, dem sogenannten „Richtwert“, war für alle Beteiligten ein Novum. Eine eigens dafür im niederländischen Bilthoven eingerichtete Abteilung der WHO unterhielt einen kurzen Draht zur Europäischen Kommission und wurde großenteils von dieser finanziert. Die Kommission stand unter Zeitdruck, weil sie laut Gesetz spätestens Ende 1996 einen Vorschlag für den neuen Grenzwert vorlegen musste.
Die von der WHO einberufenen Wissenschaftler kamen lange zu keinem Ergebnis. Im Oktober 1994 stellte eine Expertengruppe fest, ein Richtwert könne nicht wissenschaftlich hergeleitet werden, weil es keine Dosis-Wirkungs-Beziehung gibt. Angesichts dieses „Dilemmas“ nannten sie nur einen ungefähren Bereich von 40 bis 50 µg/m3 und betonten, dass dieser Vorschlag nicht auf wissenschaftlichen Berechnungen, sondern auf einer „Expertenschätzung“ beruhte – das ist die höfliche Umschreibung für eine Abstimmung nach Bauchgefühl.
Nach diesem Fehlschlag beauftragte die WHO im Oktober 1995 eine weitere Expertenrunde. Doch die in Oslo tagende Arbeitsgruppe, an der diesmal kein EU-Vertreter teilnahm, lehnte die Nennung eines Richtwertes glattweg ab. Also trommelte die WHO im Juni 1996 eine dritte Arbeitsgruppe zusammen, diesmal am Sitz der Kommission in Brüssel. Nach kurzer Beratung einigte sich die Runde darauf, den Richtwert aus einem Bericht für das Programm für chemische Sicherheit (IPCS) der Vereinten Nationen zu übernehmen. Dieser stützte sich auf jene älteren Untersuchungen über Gasherde in Innenräumen, die von den vorigen Arbeitsgruppen als unbrauchbar eingestuft worden waren. Wie es zu diesem Sinneswandel kam, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Das Protokoll der denkwürdigen Sitzung, die den bis heute gültigen Wert von 40 µg/m3 hervorbrachte, ging laut Mitteilung der Genfer WHO-Zentrale bei einem Hochwasser verloren.
Fest steht, dass die EU den Richtwert der WHO eins zu eins als gesetzlichen Grenzwert übernommen hat. Der Richtwert bezieht sich jedoch auf die individuelle Jahresbelastung, unter der keine gesundheitlichen Auswirkungen zu erwarten sind. Die Jahresbelastung eines Menschen hängt davon ab, wie lange er sich in Bereichen mit hoher Schadstoffkonzentration aufhält. Diese individuelle Exposition ist bei Stickstoffdioxid wesentlich geringer als die an der Straße gemessenen Werte, weil der Mitteleuropäer rund 90 Prozent seiner Zeit in geschlossenen Räumen verbringt.
Um das Überschreiten einer persönlichen Jahresbelastung von 40 µg/m3 zu vermeiden, hätte deshalb auch ein deutlich höherer Grenzwert ausgereicht. Die Autoren des IPCS-Berichts hatten daher ausdrücklich davor gewarnt, den Richtwert als Vorschlag für einen Grenzwert zu verstehen. Doch diese Mahnung ist offensichtlich in den Korridoren der Brüsseler Bürokratie verhallt.
Wie bei solchen Gesetzgebungsverfahren üblich, hat sich die Kommission eingehend mit den Automobilherstellern beraten. Wohl aus diesem Grund sah die schließlich im April 1999 erlassene Richtlinie vor, dass der neue Grenzwert erst ab 2010 einzuhalten sei. Dieses Ziel erschien aufgrund der damaligen Prognosen der Autoindustrie erreichbar zu sein. Mit den ab 2000 und 2005 in Kraft tretenden Abgasnormen Euro 3 und Euro 4 sollten die Emissionen trotz steigender Fahrzeugzahlen auf den Straßen innerhalb eines Jahrzehnts um 75 Prozent gesenkt werden. Dass die Automobile im Realbetrieb wesentlich mehr Stickstoffdioxid produzieren als auf dem Prüfstand, kam erst mit dem Diesel-Skandal ans Licht.
Nun wäre es denkbar, dass der Grenz-wert von 1999 trotz seiner bizarren Entstehungsgeschichte mittlerweile durch handfeste Forschungsergebnisse untermauert wurde. Dies behauptet das Umweltbundesamt (UBA) mit einem Gutachten, wonach Stickstoffdioxid in Deutschland jedes Jahr rund 6000 vorzeitige Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Diese Aussage stößt nicht nur bei den hundert Lungenärzten, sondern auch unter etablierten Epidemiologen auf Kritik.
Fest steht, dass Verkehrsabgase – auch in Deutschland – für erhebliche Gesundheitsschäden und eine Verkürzung der Lebenserwartung verantwortlich sind. Doch welche Rolle spielt dabei Stickstoffdioxid?
Das stinkende Gas mit der chemischen Formel NO2 wirkt stark oxidierend und verätzt in hohen Konzentrationen die Atemwege. Für die niedrigen Werte, die in der Außenluft gemessen werden, ist in Experimenten jedoch keine Wirkung feststellbar. Zum Schutz vor Oxidationsmitteln verfügt die Lungenschleimhaut über ein biochemisches Abwehrsystem, das NO2 und ähnliche Schadstoffe sehr schnell zersetzt. Dies ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass selbst hochempfindliche Messverfahren bei Asthmatikern erst ab etwa 180 µg/m3 biochemische Veränderungen und eine leichte Anspannung der Bronchialmuskulatur registrieren; gesunde Menschen reagieren erst auf sechsmal höhere Konzentrationen. Die gemessenen Effekte sind nicht proportional zur Konzentration des Gases, das heißt es gibt keine Dosis-Wirkungs-Beziehung. Zudem sind diese Abwehrreaktionen, die auch durch Kälte und andere natürliche Reize provoziert werden, nur vorübergehend und hinterlassen keine bleibenden Schäden.
Andererseits könnten in einer großen Population einzelne Individuen noch empfindlicher sein als die im Labor untersuchten Asthmatiker. Doch wie ließe sich das nachweisen? Wenn Kliniker und Toxikologen am Ende ihrer Kunst stehen, ist die Stunde der Umweltepidemiologie gekommen. Diese in den 1960er Jahren entstandene Disziplin versucht, durch statistische Auswertung der Daten sehr vieler Personen Korrelationen von Krankheiten und Umweltbelastungen zu finden. Doch die Beurteilung der Ergebnisse ist mitunter schwierig.
Bereits für den ursprünglichen WHO-Richtwert von 40 µg/m3 wurden umweltepidemiologische Studien herangezogen, die einen Zusammenhang zwischen Atemwegssymptomen bei Kindern und der Anwesenheit von Gasherden im Haushalt festgestellt hatten. Jedoch waren die NO2-Werte nicht oder nur ungenau bestimmt worden. Zudem war unklar, wie sich ein Gasherd in der Küche auf die anderen Räume auswirkt, die gemessenen Konzentrationen schwankten zwischen acht und 2500 µg/m3. Mangels brauchbarer Daten schätzten die Gutachter kurzerhand, dass ein Gasherd die mittlere jährliche NO2-Konzentration im Haushalt auf ungefähr 40 µg/m3 erhöht – das ist die Basis für den bis heute gültigen Grenzwert der EU. Wenn man sich damals auf „70“ geeinigt hätte, was aufgrund der Daten genauso gut (oder schlecht) begründet gewesen wäre, gäbe es in Deutschland heute keine Fahrverbote.
Ob Grenzwerte überhaupt aus epidemiologischen Untersuchungen abgeleitet werden dürfen, ist äußerst umstritten. Im Gegensatz zu ihren Kollegen im Labor sind Umweltepidemiologen in der Regel auf Daten angewiesen, die nicht für wissenschaftliche Zwecke gesammelt wurden. Die darauf basierenden „Beobachtungsstudien“ sind deshalb stärker fehlerbehaftet als kontrollierte Experimente.
Beispielsweise sind die in den Sterberegistern verzeichneten Todesursachen oft ungenau. Auch die den Wohnorten (in der Regel nach Postleitzahlen) zugeordneten NO2-Werte der Außenluft sind nur grobe Näherungen. Weil es nur wenige Messstationen gibt, werden sie mit Hilfe mathematischer Modelle geschätzt. Ein Fehlerintervall von plus oder minus 30 Prozent gilt hier als akzeptabel. Zusätzlich führen lokale Effekte wie Anfahrvorgänge an Verkehrsampeln oder stehende Luft in engen Straßen zu örtlichen und zeitlichen Schwankungen, die in den Modellrechnungen nicht berücksichtigt werden. Der Gesamtfehler entsteht durch Multiplikation der Einzelfehler, so dass die Interpretation mancher Studien an Kaffeesatzlesen erinnert. Bei gesetzlichen Grenzwerten haben jedoch, wie man am Beispiel der Diesel-Fahrverbote sieht, bereits geringe Überschreitungen erhebliche Konsequenzen.
Zudem sagen epidemiologische Assoziationen, selbst wenn sie gut belegt sind, nichts über kausale Zusammenhänge aus, weil die beobachteten Effekte auch unbemerkte Ursachen haben können. Diese sogenannten „Confounder“ haben als unbekannte Dritte den Epidemiologen schon so manchen Streich gespielt. Für Aufregung sorgten etwa Studien aus den 1980er Jahren, die einen Zusammenhang zwischen Kaffeetrinken und Krebs nachwiesen. Wie sich später zeigte, war dafür ein Confounder verantwortlich: Kaffeetrinker rauchen häufiger, und Rauchen verursacht Krebs. Dieses Beispiel mahnt deshalb zur Vorsicht, weil man die krebsfördernde Wirkung des Rauchens natürlich von Anfang an kannte und es trotzdem nicht gelang, diesen Confounder herauszurechnen.
Für NO2 sind diese Störfaktoren kaum kontrollierbar. So wurden in den historischen Gasherd-Studien Luftfeuchtigkeit und Raucher im Haushalt nur teilweise dokumentiert. Heute weiß man, dass die Häufigkeit von Asthma- und Erkältungssymptomen entscheidend vom Rauchverhalten der Mitbewohner und der Luftfeuchtigkeit abhängt. Bei der Verbrennung von Gas entsteht so viel Wasser, dass die Feuchtigkeit mitunter am Küchenfenster kondensiert. Gasherde standen meist in sozial schlechter gestellten Haushalten und wurden teilweise auch zum Heizen verwendet.
Der hartnäckigste Störfaktor für die Beurteilung von Gesundheitsschäden durch NO2 sind andere Verbrennungsprodukte, insbesondere Ruß und Feinstaub. Diese Partikel lagern sich über Jahre hinweg in der Lunge ab und können zudem toxische Schwermetalle und organische Verbindungen transportieren. Im Vergleich zu NO2 sind bei Feinstaub die Beweise für kurz- und langfristige Gesundheitsschäden und eine Verkürzung der Lebenserwartung eindeutig. Epidemiologische Studien können diesen Confounder jedoch nicht herausrechnen, weil der besonders gefährliche Feinstaub unter 2,5 Mikrometer Partikelgröße nicht flächendeckend gemessen wird. Zudem fehlt bei NO2 ein plausibler biologischer Mechanismus für Schädigungen außerhalb der Lunge.
Deshalb stufen die amerikanische Umweltbehörde EPA, die WHO und eine von der britischen Regierung eingesetzte Expertenkommission bei NO2 nur kurzfristige Effekte auf die Atemwege, insbesondere die Verstärkung von Asthmasymptomen, als kausal ein. Mitentscheidend war die durch zuverlässige Studien abgesicherte Beobachtung, dass bei hoher NO2-Belastung in der Außenluft mehr Asthmatiker in die Notaufnahmen kommen. Allerdings wurden hier, wie die EPA feststellte, in der Regel auch die amerikanischen Grenzwerte für NO2 überschritten. In Regionen, in denen die Grenzwerte eingehalten werden, zeigte sich keine Korrelation von NO2-Belastungen und Asthmaanfällen. Die EPA schließt daraus, dass der in den Vereinigten Staaten gültige Jahresgrenzwert von 100 µg/m3 zum Schutz der Bevölkerung ausreicht. Dabei unterscheidet die EPA im Gegensatz zur EU-Kommission zwischen der persönlichen Exposition (auf die sich der Richtwert der WHO bezieht) und dem gesetzlichen Grenzwert für die Messstationen. Diese differenzierte Betrachtung – und nicht etwa eine laxere Einstellung zum Gesundheitsschutz – ist der Grund für den höheren Grenzwert in den Vereinigten Staaten.
Für andere Gesundheitsschäden, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Todesfälle, konnten die internationalen Gutachter keinen ursächlichen Zusammenhang mit der NO2-Belastung feststellen. Wie kommt also das Dessauer Umweltbundesamt auf die angeblich 6000 Herz-Kreislaufbedingten NO2-Toten? Das UBA-Gutachten basiert auf sechs älteren Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen Todesfällen und den NO2-Belastungen am letzten Wohnort zeigen. Daraus ermittelten die UBA-Autoren ein erhöhtes Sterberisiko von drei Prozent pro 10 µg/m3 NO2. Mit Hilfe per Modellrechnung geschätzter regionaler NO2-Expositionen und der amtlichen Todesursachenstatistik ergab sich eine Verkürzung der statistischen Lebenserwartung, die etwa 50 000 verlorenen Lebensjahren entspricht. Das rechneten die UBA-Experten in 6000 Personen um, die angeblich vor Erreichen der durchschnittlichen Lebenserwartung versterben.
Für die behauptete Kausalität zwischen NO2-Exposition und vorzeitigen Todesfällen, die im Widerspruch zum internationalen Stand der Wissenschaft steht, hat das UBA keinen einzigen Beleg vorgelegt. Offenbar wurden nicht einmal die bekannten Confounder der Ausgangsstudien berücksichtigt. Der Bochumer Epidemiologe Peter Morfeld hat zu Recht darauf hingewiesen, dass auch die Umrechnung der verlorenen Lebensjahre in Todesfälle mathematisch nicht korrekt ist: Da niemand weiß, wie sich die verlorenen 50000 Jahre auf die Bevölkerung verteilen und nicht jeder exakt nach Ablauf der durchschnittlichen Lebenserwartung stirbt, kann man nicht ausrechnen, wie viele Menschen tatsächlich früher sterben. Weil fiktive Sterbezahlen in der Öffentlichkeit leicht missverstanden werden, macht die WHO solche Angaben nur in Fällen, wo die tödliche Wirkung grundsätzlich feststeht, etwa bei Aids oder der Luftverschmutzung insgesamt. Dies trifft aber auf NO2 nicht zu.
Der Hinweis, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen NO2 und Sterblichkeit nicht belegt ist und die „Stickstoffdioxid-Toten“ gar keine echten Toten sind, hätte die Debatte frühzeitig entschärfen können. Stattdessen sieht das UBA bis heute zu, wie die (fiktiven) 6000 NO2-Toten mit den 3500 (realen) Verkehrstoten ins Verhältnis gesetzt werden. Diese gefährliche Nähe zu Fake News und Fake Science nützt nicht der Umweltpolitik, sondern spielt ihren fundamentalistischen Gegnern in die Hände.
Die Hauptautorin der Studie, die international angesehene Feinstaub-Expertin Annette Peters vom Münchner Helmholtz-Zentrum, ist derweil diskret zurückgerudert. In ihrer jüngsten Übersichtsarbeit zu Luftschadstoffen werden die angeblichen NO2-Toten nicht mehr erwähnt. In öffentlichen Stellungnahmen betont sie schon länger, dass die verlorenen Lebensjahre auch andere Gründe haben könnten – sogar Straßenlärm schließt sie als Mitursache nicht aus. Damit ist es höchste Zeit, den politisch befeuerten „Streit der Experten“ auf dem Friedhof der wissenschaftlichen Peinlichkeiten zu begraben. Was bleibt?
Die Politik hat die Deutschen in die Diesel-Falle gesteuert, und nur die Politik kann sie daraus wieder befreien. Seit vergangenem Jahr läuft die turnusmäßige Überprüfung der Luftgrenzwerte durch die EU-Kommission. Die Fachleute der WHO, die damit beauftragt sind, haben schon deutlich gemacht, dass sie weitere Verschärfungen empfehlen werden. Bei Feinstaub steht die medizinische Begründung für strengere Grenzwerte, wie sie in den Vereinigten Staaten bereits gelten, außer Frage. Ob das in Brüssel durchsetzbar ist, wird jedoch insbesondere von osteuropäischen Staaten abhängen, die bereits die derzeit gültigen Regelungen nicht beachten.
Bei NO2 ist die Lage anders. Selbst wenn die WHO den Richtwert von 40 auf 20 µg/m3 herabsetzen sollte, gibt es keinen Grund, den Grenzwert zu verschärfen. Die durch den Richtwert angegebene, noch nicht gesundheitsschädliche persönliche Exposition wird auch dann nicht überschritten, wenn an stark befahrenen Straßen höhere Konzentrationen auftreten. Diese in Amerika selbstverständliche Differenzierung muss auch in die Überprüfung der EU-Grenzwerte Eingang finden.
Trotzdem wäre es vorschnell, in Brüssel eine Aufweichung der Regeln für NO2 zu fordern. Weniger umweltbewusste Mitgliedstaaten würden nach dieser Steilvorlage die Luftreinhaltungspolitik insgesamt in Frage stellen. Zudem ist NO2 ein Indikator für andere Abgasbestandteile wie Feinstaub und Ruß, die derzeit nur teilweise gemessen werden. Durch die neuerdings endlich verstärkten Anstrengungen zur Luftreinhaltung und die Ausmusterung älterer Dieselmodelle wird Deutschland den Grenzwert ohnehin in wenigen Jahren flächendeckend einhalten.
In der Übergangszeit wird es Aufgabe der Justiz sein, die Schieflage zwischen dem gesetzlichen Grenzwert, den Handlungsoptionen der Gemeinden und den Rechten der Bürger zu korrigieren. Die gerade vom Bundestag verabschiedete Änderung des Immissionsschutzgesetzes, wonach Fahrverbote erst ab 50 µg/m3 angeordnet werden sollen, dürfte dabei wenig hilfreich sein. Der EU-Grenzwert hat unmittelbare Gesetzeskraft und ist einzuhalten, auch wenn nationales Recht dagegen steht. Und die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit, auf die das Gesetz vorrangig abzielt, ist ohnehin verfassungsmäßige Aufgabe der Gerichte.
Hingegen könnte die Tatsache, dass die dem NO2 zugeschriebenen Gesundheitsschäden ganz oder teilweise durch andere Abgaskomponenten verursacht werden, die Verfahren aus der Sackgasse befreien. Der Austausch von Diesel-Pkw durch Benziner führt zwar zur Reduzierung von NO2, aber zur Erhöhung des wesentlich gefährlicheren Feinstaubs. Zudem werden durch Umleitungen auf Nebenstraßen nicht selten mehr Menschen einer Feinstaub-Belastung ausgesetzt, die auch bei Einhaltung der NO2-Grenzwerte gesundheitsschädlich ist. Fahrverbote können deshalb die Gesundheitsrisiken erhöhen, so paradox das auf Anhieb klingen mag. Eine Maßnahme, die den Teufel mit dem Beelzebub austreibt, dürfte in keiner Hinsicht verhältnismäßig sein.
Der Auftrag von Bundeskanzlerin Merkel an die Nationale Akademie der Wissenschaften, im sogenannten „Expertenstreit“ zu vermitteln, hat der öffentlichen Debatte um das Diesel-Desaster eine Atempause verschafft. Doch wenn die Leopoldina mit ihrem in Kürze erwarteten Gutachten die wissenschaftlichen Fakten zurechtrückt, wird vor allem eines noch einmal deutlich werden: Der Ball liegt unbewegt im Feld der Politik, und das seit zwanzig Jahren.
***
Der Autor ist Direktor des Instituts für Biologische Sicherheitsforschung in Halle und war langjähriger Berater der Bundesregierung für biologischen Bevölkerungsschutz.
Veröffentlicht unter Allgemein
Hinterlasse einen Kommentar
Das ist der Hammer: Bohrmaschine gesucht!
Ich will eine Bohrmaschine kaufen: nur welche? Was muss sie können und was darf sie kosten? Eine unerwartet langwierige Geschichte mit Enttäuschung im Fachhandel.
Kann es denn so schwer sein, eine Bohrmaschine zu kaufen? Dieses in den Augen Vieler unverzichtbare Gerät und, so scheint es fast, elektromechanische Instrument heimwerkerlicher Mannwerdung fehlt – mir und meiner „Werdung“ in meinen Augen gar nicht, aber meinem Werkzeugarsenal dann doch, denn in die Wände unserer Wohnung lassen sich Nägel schlicht nicht schlagen. Dass es eine normale Bohrmaschine nicht sein darf, sondern eine Schlagbohrmaschine, war klar. Auf der ungetrübt optimistischen Suche kam der Begriff „Bohrhammer“ hinzu, und damit begann die Schwierigkeit, ein Gerät auszusuchen, das nicht völlig überdimensioniert einem vermeintlichen handwerklichen Geltungsbedürfnis entspringt, das aber ebensowenig einer demonstrativ sparsamen und pseudo-realistischen Zurückhaltung wegen deutlich zu leistungsschwach ausgewählt wird. In einer Liga von rund 180 Euro bewege ich mich derzeit, und ich schränke meine Suche willkürlich auf die Marke BOSCH ein. Besser ist das, sonst würde ich im Dickicht der Marken von Dewalt bis Fein, von Makita über Milwaukee bis Hilti völlig die Orientierung verlieren. Es reicht, zwischen „GSB“ und „GBH“ planlos den Kopf zu schwenken. Zusätze wie DFR, DRV, RE, RCT u.a. konnte mir der Mitarbeiter des Superwerkzeugfachhandels auch nicht erklären. Dort, so war ich fest entschlossen, wollte ich gestern eine Bohrmaschine kaufen, nicht im Baumarkt, wo ich mangels Ansprache mehrfach um ein Gespräch mit Personal herumgekommen war, und nicht im Internet, beispielsweise bei Amazon. Dort nämlich bestellen laut Fachhandelsverkäufer alle Kunden, die sich wie ich vor Ort beraten lassen, Preise vergleichen und dann von dannen ziehen. Bloß günstigst kaufen, durchaus ein pathologischer Umtrieb und ein eigenes Thema wert. Dass ich Preise einzelner Geräte im Notizzettel meines iPhones notiert hatte, machte mich bald verdächtig. Dass ich normalerweise im Internet recherchiere, mich vorinformiere um dann im stationären, analogen Geschäft zu kaufen, kam dem Herren mit den magnetisch aneinander haftenden Brillenhälften nicht in den Sinn. Ob ich noch mal die Gelegenheit haben werde, ihm das bei meinem Kauf zu erläutern, weiß ich nicht. Denn das Gespräch mit ihm hat mich – bedauerlicherweise! – tatsächlich auf die Idee gebracht, online zu kaufen. Denn keine wirkliche Beratung bekomme ich auch im Netz, allerdings muss ich mir dort nicht unwissend, ja regelrecht dumm und naiv vorkommen. Es bedurfte einer gewissen bewussten Gelassenheit, nicht bald das Weite zu suchen. Wie Bohrhämmer funktionieren, und was sie technisch vom Schlagbohrer unterscheidet, wusste ich nicht; auch nicht, was SDS ist, geschweige denn in der Variante „max“ oder „plus“. Woher auch? Und warum auch, zum Teufel?! Als ich die Schlagbohrmaschine meines Vaters (ich glaube, es war eine blassblaue AEG, mit Hammer-Symbol und Bohrer-Symbol an einem Umschalter, und in Kinderohren beängstigend laut) zuletzt in den Händen hielt, wurde der Bohrer noch mit Hilfe eines Bohrfutterschlüssels arretiert, und ich wurde unterwiesen, darauf zu achten, dass der auch senkrecht im Futter sitzt und nicht „eiert“. Das ist auch schon mindestens 25 Jahre her.
Zurück zu meiner ungelösten Aufgabe: unbefriedigt, fasst schon etwas unglücklich über die nicht erfolgte Ausrüstung mit dem begehrten und im Haushalt auch benötigten Gerät, fuhr ich wieder nach Hause. Ein schlechtes Gewissen hatte ich obendrein, denn meiner Frau hatte ich versprochen, endlich das Windlicht an der Balkonwand zu befestigen (auch hier ein Nagelkiller, nur mit Hammer und Metallstift aussichtslos), die Pinnwand aufzuhängen und dies und das zu erledigten, was ich wegen fehlenden Werkzeugs bislang aufschieben konnte. Nächster Schritt: zurück ins Internet, auch zu Amazon und auf die Website von BOSCH. In Foren gibt es Rat, aber auch der ist für mich nicht eindeutig nachvollziehbar. Ich will doch in den Fachhandel, ich suche das persönliche Gespräch und ich möchte mit jemandem Reden, der mir eine eindeutige Empfehlung macht und mir letztlich tatsächlich auch etwas verkauft. Fast wäre es am Samstag Vormittag ein „GSB“ geworden, aber auf den Hinweis, dass mir der Magnetbrillenmann dann auch noch Bohrer verkaufen müsse, kam der Hinweis, dass es für das klassische, alte Bohrfutter nur sehr wenig Auswahl gebe – die meisten Einsätze seien schon für SDS-Systeme gemacht, mit den länglichen Rillen am Schaft, wegen der Beweglichkeit im Zusammenspiel mit dem Hammerwerk. Dass ein zweites Bohrfutter notwendig sei, wenn ich mal in Holz oder Metall bohren will, oder in eine Mauer ohne zu hämmern, hat mich vollends verwirrt. Hammerwerk abschalten allein reiche nicht aus, erfuhr ich. Mangels konsistenter Erklärungen und dem Willen, sich mir und meiner Unwissenheit mit etwas mehr Zuneigung zu widmen, als das bei den sicherlich normalerweise fragenfrei einkaufenden Profis erforderlich ist, kam ich nicht ans Ziel, und so bin ich immer noch auf der Suche nach der Antwort auf meine Frage, welche Schlagbohrmaschine ich sinnvollerweise kaufen soll. Vielleicht schreibe ich morgen mal dem Hersteller oder rufe dort an. Könnte ja sein, dass die Mitarbeiter von BOSCH selbst die eine oder andere hilfreiche Idee dazu haben. „It’s in your hands“, um es mit ihren eigenen Worten zu sagen.
Da Probieren bekanntlich über Studieren geht, habe ich zwei alte Maschinen bei einem Freund geliehen, um damit erste eigene Dreh-Drück-Versuche in vivo zu machen.

Ich hoffe, dass die Praxis hilft, eine gute Entscheidung zu treffen. Sollte die Umsetzung, d.h. auch der Umsatz, dann im Netz erfolgen, so hat es der Fachhandel in diesem Fall mal wieder nicht besser verdient. Der größte Feind des Einzelhandels ist der Einzelhandel selbst, wie mir immer wieder scheint.
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit bohren, Bohrhammer, Bohrmaschine, BOSCH, Dübeln, Einzelhandel, Heimwerker, Schlagbohrmaschine, Werkzeug
2 Kommentare
Laube. Liebe. Hoffnung?
Laube. Liebe. Hoffnung? Lokal-Termin in Frankfurt.
Laube:
Ein ungewöhnlicher Bau in etwas gewöhnungsbedürftiger Umgebung der Trabantenstadt auf dem früheren Güterbahnhofsgelände. Ganz schick, wahrscheinlich auch „cool“, mit offener Küche, schmal und länglich, und wahrscheinlich in kalten Jahreszeiten auch gemütlich. in der Sommerhitze sitzt man ganz angenehm draußen, auf schweren Stühlen und unter Sonnenschirmen; mit der Dämmerung kommt angenehme Beleuchtung dazu. Die Location gefällt, wir haben uns bezüglich der äußeren Rahmenbedingungen wohl gefühlt.
***
Liebe:
Der erste direkte Kontakt zum Personal ist der telefonische, um anzufragen, ob der für 20:30 Uhr online reservierte Tisch schon früher zur Verfügung stünde. Die Dame spricht deutllich, nennt ihren Namen und ist sehr nett – ein sehr guter Auftakt! Man können es nicht versprechen, würde es aber versuchen, ein freier Tisch ggf. 30 Minuten vorher sei machbar, gerne könne man die Wartezeit mit einem Aperitif an der Bar verbringen. Auch die Begrüßung ist gut, die für die Reservierung und Platzierung zuständige Mitarbeiterin ist im persönlichen Kontakt nett, gut gelaunt, zupackend und sympathisch. Wir bekommen einen Tisch, werden über den Abend hinweg gut bedient und fühlen uns in Sachen Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, d.h. in puncto Service gut bedient. Besonders erwähnenswert finde ich, dass wir alle Weine probieren durften, die uns zum Essen interessierten. Anstandslos, man hätte auch noch ein oder zwei weitere Probiergläser gebracht, damit wir den richtigen Wein finden. Die Weinauswahl ist hinsichtlich Auswahl und Preise angemessen und bietet unbekannte(re) Weine abseits vom Mainstream der (Frankfurter) Gastronomie.
***
Hoffnung:
Der Laden: check! Die Leute: check! In der B-Note gibt’s hohe Punktzahlen und durchweg vier Sterne. Es gibt allerdings einiges in unserer Wahrnehmung, bei dem deutliches Verbesserungspotential besteht – leider auch und vor allem in der Disziplin, die für die A-Note die wichtigste ist: Essen.

Gleich vorweg: es war einiges gut, manches ok, anderes inakzeptabel.
Die Tomatenkaltschale erweist sich als lecker, in ihrer schieren Menge (Gemüse, so viel Gemüse!) als unbezwingbar und sättigend, dass das als kalter Hauptgang anzubieten wäre. Gut gemeint, ich will Sparportionen nicht das Wort reden, aber das war zuviel, auch ein bisschen zu scharf auf Dauer.

Die Zuckererbsensupper war sehr lecker, ich habe nichts auszusetzen, außer dass diese auch an einem Tag brütender Hitze hätte heißer sein müssen.

Zu den Hauptspeisen: Kalbsleber in dünnen Scheiben, weich und saftig. Prima. Aber der Rest! Und das Anrichten! Ein riesen Haufen, seitlich das Pürree, hinten die Leber, dazwischen wiederum etwas, das wohl gut gemeint, leider im Ergebnis aber übertrieben und untauglich wirkt: kleine Perlzwiebeln sind eine gute Idee, finde ich, um von der „normalen“ Zwiebel zur Leber abzuweichen. Apfel dazu? Ich mag’s nicht, aber die hier untergemischten Scheiben lasse ich mir gefallen. Zuviel wird’s spätestens mit den Trauben, also eigentlich Wein- oder Tafelbeeren, riesig, dafür halbiert aber immer noch zu groß, und viele davon. Zu viele. Eine kleine Strauchtomate dekoriert, begleitet von Sprossen, Süßkartoffelchips (nicht knusprig) und einer Blüte. Die gab’s zuvor schon in der Suppe und in der Kaltschale (eine andere, weiße Blüte), und auch dieses Detail ist des Guten zuviel. Überlasst doch diese (schmucken!) Tellergirlanden den Thailändischen Restaurants. Was fehlt? Mehr von der leckeren Sauce! Eine Kalbsleber, die überinterpretiert wird, mit zuviel von fast allem und einem Geschmackserlebnis, das nicht schlüssig ist.

Die größte Enttäuschung (im wörtlichen Sinne) war die „Abendempfehlung“. In einem uns unbekannten Lokal würde wir nie das teuerste Essen bestellen, und wenn uns unsere Erinnerung nicht täuscht, bekamen wir mit dem zweiten Hauptgang genau das: das teuerste Essen. Flussbarsch auf Risotto für 28 Euro, mit Pilzen und Erbsen (!?), einer gelben und einer grünen Sauce und einem weißen Schaum, eher einem Schäumchen, das wir wohl zeitgemäß als „Espuma“ bezeichnen müssten. Abgesehen vom Preis an sich, über den man noch diskutieren könnte und nach dem wir uns – Auswahlverschulden, würde der Jurist sagen – leider schlicht nicht erkundigt hatten, ist das Hauptproblem das der Preiswürdigkeit, die nicht gegeben ist. Auch dieser Teller ist ein Beispiel des „zuviel“, leider aber auch des „nicht gut“: das Risotto ist keins. Punkt. Das ist eine Reisbeilage, für die man bei einer italienischen Hausfrau bestenfalls ein mitleidiges Lachen erhält. Mit der Mischung aus Hülsenfrüchten und Pilzen ergab sich auch hier kein „ach ja“, „oh, gut“, „hmm, wie lecker“ oder „hätt’ ich nicht gedacht, das merke ich mir“. Es war gelinde gesagt nicht schlüssig. Das schlechteste zum Schluss: der Fisch. zu trocken, zu lange gegart. Leider. Nicht schlecht, und wir hätten das ganze zurückgeben können, ja. Wollten wir aber nicht, weil wir keine Lust auf Reklamation, Rechtfertigung und Wartezeit hatten. Dafür sind 28 Euro schlicht nicht in Ordnung, weswegen wir die unvorsichtige Wahl der Abendempfehlung reuen.

Der Molitor-Sekt (0,1 für 6,50 Euro) enttäuscht, da gäbe es im Rheingau besseres und günstigeres, auch wenn der Winzer keine 100 Punkte hat), ein „Lillet Berry“ für 7,50 Euro ist womöglich angemessen, wenn man sich in der Gastro umschaut, ebenso die 7,30 Euro für eine Flasche „BlackForest“ Mineralwasser. So richtig freundlich fanden wir keinen der Preise, Lust auf mehr kommt kaum auf, und es wäre schön, wenn der Espresso zum Schluss seinen Namen verdiente. Zuviel auch hier, leider sauer und überextrahiert, keine Crema – für 2,20 Euro nicht teuer, aber für die Qualität des Produkts leider auch nicht angemessen.
Zwei weitere Kleinigkeiten: die Baulampen an den Stufen der Terrasse weichen ja vielleicht bei Gelegenheit noch moderneren und schickeren Exemplaren, wie sie im Turm des Gebäudes zu sehen sind (LED?). Und ein kleines Gebläse zum Trocknen der Hände im WC ist in meinen Augen nicht zeitgemäß, hält auf und nervt. Vielleicht kann man hier mal Papierhandtücher vorhalten, wenigstens ergänzend. Wenn das Konzept wirtschaftlich aufgeht, sollte dafür Geld übrig sein.
Wir sind ent-täuscht von unserem ersten Besuch. Ob wir wiederkommen, wissen wir noch nicht. Aber irgendwie wäre es schon toll, wenn „Laube Liebe Hoffnung“ ein lohnendes Ziel wäre. Es hatte so gut angefangen. Und einen so langen Text schreibe ich irendwie auch, weil ich mir wünsche, dass die Menschen der Laube ihre Liebe noch ein bisschen ausbauen und uns Gästen Grund zur Hoffnung geben.
Veröffentlicht unter Gastronomie
Verschlagwortet mit Essen, Frankfurt, Gastronomie, Hoffnung, Kritik, Laube, Liebe, Trinken
Hinterlasse einen Kommentar
Ultraschall
Den Aufenthalt in einer Notaufnahme kann ich nicht empfehlen.Dass Ärzte beim Ultraschall etwas erkennen können, habe ich mit laienhaften Blick auf das Schlierenbild in Graustufen eigentlich schon immer bezweifelt. Den Beweis lieferte vor ein paar Jahren die Notaufnahme in Ludwigsburg und jüngst jene des Uniklinikums in Frankfurt. Den Muskelabriss in der Wade erklärte man mir als Muskelfaserriss, eigentlich nicht mehr als ein schlimmer Muskelkater; die Gallenkolik wurde, nachdem der Infarkt mit zweitem EKG und erweitertem Blutbild ausgeschlossen war, zur Gastritis erklärt. Wundersamerweise habe selbst ich beim Kontroll-Ultraschall heute Dinge gesehen, die ich sah, weil man sie nicht übersehen kann. Eigentlich. Wenn man hinschaut. Und nicht so muffelig-lustlos den Schallkopf über den Bauch fährt. War ja auch bald Schichtende, wie ich von der Ärztin erfahren habe, die um sechs die Frühschicht antrat und den jungen Kollegen ablöste, nachdem dieser sich grußlos verabschiedet und zum Befund nichts gesagt hatte. Wie auch, der er hatte anscheinend keinen. Richtigen. Nach knapp zwei Wochen Magensäurereduktion und Alkoholentzug – die warnende Schilderung der Ärztin enthielt die Worte Fettleber, Diabetes, Leberzirrhose, Transplantation und andere – war jetzt ein Internist mit der Nachuntersuchung dran. Mit Ultraschall. Mit Erläuterung dessen, was er sieht und was er davon hält. Mit deutlichst erkennbaren Gallensteinen. Von denen hätte auch ein übermüdeter Assistenzarzt mindestens fünf sehen müssen. Diese fünf habe ich gezählt, aus etwa zweieinhalb Metern Entfernung. Der Schluss: das Ding muss raus, bald. Auf zur Cholezystektomie. Darauf trinke ich heute mit meiner Verlobten erst einmal einen schönen Wein…!
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit Ärzte, Galle, Herzinfarkt, Kolik, Leber, Notaufnahme, Ultraschall
Hinterlasse einen Kommentar
Auf dem Weg: RUX Sauvignon Blanc „Überm Weg“
„Stachelbeeere!“ schien der Sauvignon Blanc aus dem Remstal zu schreien, jeder den ich letzten Januar in der Fellbacher Kelter probiert hatte. Meist durchaus lecker, aber leider auch fast alle einander sehr ähnlich und damit eintönig. So ist mir der Württemberger Sauvignon Blanc meist begegnet und ich trank ihn selten. Mit Müller-Catoir habe ich einen zuverlässigen Dealer in der Pfalz, Villa Vitas ist zuverlässiger Partner im Friaul, um nur zwei zu nennen.
Nun ergab es sich, dass mir ein Sauvignon Blanc über’n Weg (falsch, aber des Wortspiels und der Weintrinker aus dem Ruhrgebiet wegen: über’m Weg) lief, mit dem ich nicht gerechnet habe. Zum einen wusste ich gar nicht, dass es ihn gibt (Stand heute für den Jahrgang 2012: gab), zum anderen wusste ich nicht, was in der Flasche ist. Jetzt weiß ich es, und ich bin überrascht.
*Alle Freunde der Stachelbeere, der offensiven Frucht und Exotik können hier aufhören zu lesen*
Trocken, etwas verhalten und mit leisem Duft kommt er daher, unaufdringlich und für mich ungewöhnlich, vor allem unerwartet. Und er ist so mineralisch, dass er fast knusprig wirkt, man beinahe anfängt zu kauen. In der Nase dezent, im Mund knackig, mit einem kleinen Hauch Stachelbeere und, vielleicht den herbstlich getunten Geschmacksknospen geschuldet, mir kommt (merkwürdigerweise?) Quitte in den Sinn. Auf dem Berg ist er noch nicht angekommen, auf dem Weg dort hin ist er vielleicht. Wenn es einen 2013er geben wird, bin ich auf jeden Fall am Start!
(Verkostungsnotiz vom 28.12.2013)
Veröffentlicht unter Wein
Verschlagwortet mit Baden-Württemberg, Rux, Sauvignon Blanc, Wein, Weingut Ruck
1 Kommentar
Missa Solemnis – Gardiner II – Mit Staunen hört das Wunderwerk
Es ist schier unfassbar, was die Sänger, insbesondere die des Chores, leisten. Alleine Gloria und Credo hauen einem die Mütze vom Kopf, pusten die Ohren durch, während die Augen den Noten im KA folgen, hoch konzentriert, staunend, mitgerissen und euphorisch. Das ist nicht nur eine Messe, das ist eine ganz Hohe Messe, große Kunst und höchstes Gotteslob mit Verve, Inbrunst und Engagement. Spontan nominiere ich diese CD zum „Best Buy“ des vierten Quartals, und sie ist sicherlich eines der Highlights des Jahres, wenn nicht sogar „Best Buy 2013“. Und dabei habe ich von Kyrie, Sanctus und Agnus Dei noch gar nicht gesprochen…
Übersetzungen sind nicht so meins, dennoch habe ich es versucht und diese Version auf der Facebook-Seite des Monteverdi-Chores veröffentlicht:
It is just about unbelievable, inconceivable, what the singers, especially those in the choir, accomplish. Gloria and Credo alone knock my socks off, clear the ears, while the eyes follow the notes in the vocal score, highly concentrated, amazed, swept away, euphoric. That is not just a mass, that really is a High Mass, great art and highest praise of God, with panache, fervor and dedication. I spontaneously nominate this recording as Best Buy“ of the fourth quarter, and it surely is one of this year’s highlights, if not even „Best Buy 2013“. And I haven’t even mentioned Kyrie, Sanctus and Agnus Dei…
Veröffentlicht unter Musik
Verschlagwortet mit Beethoven, Gardiner, Missa Solemnis, Monteverdi Choir, SDG
2 Kommentare
A big Hooray for Susie K.!
Ein Fundstück am Sonntag. Drei versuchte Limericks zum Geburtstag meiner früheren Schulorchester- und Band-Direktorin.
Der Pauker war ich…
A big Hooray for Susie K.!
There was a conductress named Susie,
You had to be there so you could see
How she led the Blue Bands,
And leading with firm hands,
She made us her sounding jacuzzi.
A young German nick-named „Hans Solo“,
Unwilling to play the piccolo.
He thought for a glimpse,
Then settled for timps
And was blessed with a one-year crescendo.
There once was special conductress,
Whose love for our music was trendless.
She harnessed us teens,
Showed what music means,
Our affection in turn will be endless.
Veröffentlicht unter Allgemein
Verschlagwortet mit Blue Band, Hagerstown, Limerick, Musik, Susie, Williamsport
Hinterlasse einen Kommentar
Shockwork Orange – Enttäuschte Erwartung an das Unwiderstehliche
Was für ein arroganter Name: Himmel auf Erden. Geht’s ein bisschen kleiner?
Vorgeschichte:
Ich erinnere mich beim Lesen des Namens im PDF von Calistoga an Graf Adelmanns „Das Lied von der Erde“ – als Klassikfan, begeistert insbesondere auch für die Musik Gustav Mahlers, dachte ich: „Was für ein arroganter Name!“, und kam nicht umhin eine Flasche davon zu kaufen. Sehr geiler Name! Der Versuch ging ärgerlich schief (im Gefrierfach vergessen, „aufgefroren“, teure Schusseligkeit und Eile) und endete sozusagen gleich mit dem ersten Satz von Mahlers Sinfonie, dem „Trinklied vom Jammer der Erde“, nur dass ich ohne Trank mit dem Jammer allein war. Ein zweiter Versuch, zusammen mit meinem Vater (eine Quelle meiner Musikliebe und auch Mahlerfan), ist später geglückt. Ein toller Wein, aber es bleibt beim einem arroganten Namen…
Vom Lied nun direkt in den Himmel: kein Bier, kein Manna, Wein soll es sein, der mich dort hinführt.
Gemäß dem telefonischen Rat der netten Sommelière (liebe Grüße an Bianca!) habe ich den Wein dekantiert. Nein, karaffiert natürlich („dekantieren“ und „karaffieren“ sind beim Wein, was „Panierung“ und „Panade“ beim Essen sind).
Trüb und schmutzig, auch im Geruch und Geschmack. Es erinnert, verstärkt durch die Zeichnung auf dem Etikett, an Dinge, die ich hier gar nicht zu benennen wage. Nicht vom Duft, aber von der Art, schmutzig, etwas abstoßend und doch anziehend zu sein. Ich kann dann doch nicht davon lassen. Und das ist dann schon auch geil, in welchem Sinne des Wortes man das auch immer verstehen mag.
Mostig ist die Brühe, Apfelmost und Federweißer kommen mir in den Sinn; etwas säuerlich ist er und irgendwie ganz anders, als ich ihn mir seit Tagen der Vorfreude ausgemalt hatte. Wie genau, kann ich gar nicht sagen. Aber anders. Leckerer. Umarmend-einnehmend leckerer.
Kolophonium ist dabei, und das kam mir schon vom Wort sehr lange nicht mehr in den Sinn, war quasi gestrichen… sowas wie Zesten von Zitrusfrüchten, herb in der Nase und im Mund, und ziemlich kurz. Schluck und weg. DAS soll der Himmel auf Erden sein? Sowas kann nur einem morbid-masochistischen Wiener einfallen. Aber dass man im Burgenland so drauf ist?!
Einen veritablen „Orange Wine“ habe ich in Karaffe und Glas, wenn ich Dirk Würtz richtig verstanden habe: „maischevergoren“ heißt das Zauberwort, und das steht sogar auf dem Etikett.
Der Wein hat Luft, der Wein hat Zeit, ich schreibe diese Zeilen und merke mit jedem Schluck des sich erwärmenden Weins, dass dieser sich verändert. Es bleibt die Säure, die hinten die Kehle kitzelt, es bleibt das Derbe im Charakter…und doch…kommen Noten zum Klingen, die ich nicht erwartet hätte… „Rive Gauche“ von Yves Saint Laurent klingelt in den Erinnerungswindungen des Hippocampus, Blumen, feucht-floral, weiße Blumen, die ich mir nie merken kann – sind es Lilien? Die standen doch neulich beim Thai in Stuttgart… „Und eine neue Welt entspringt“ wäre die Worte eines anderen musikalischen Österreichers für das, was ich jetzt im Glas habe. Faszinierend, vielseitig, vielschichtig und abwechslungsreich, das ist er auf jeden Fall. Er ist so stark anziehend, dass ich nicht davon loskomme. Allerdings wandern zwei Drittel wieder in die Flasche und werden morgen und Sonntag zeigen, was passiert. Was bleibt? Eine „geile Enttäuschung“ könnte ich es nennen, sicherlich „Wein am Limit“ und ich bin gespannt auf den 2011er Bruder dieses Weines, nicht „orange“, sondern klassisch (?) und wahrscheinlich zivilisierter.
Veröffentlicht unter Wein
Verschlagwortet mit Österreich, Calistoga, Himmel auf Erden, maischevergoren, Orange Wine, Scheurebe, Tschida, Wein
2 Kommentare